IM FOKUS:
Das Zoetrop: Animationen wie vor 150 Jahren.
Die Zoetrop-Animation gehört zu den beliebtesten Animationstechniken vor Erfindung des Films. Entwickelt in den 1830er-Jahren wurden Wundertrommeln zu einem beliebten Spielzeug des 19. Jahrhunderts. Studios wie Pixar arbeiten auch heute noch mit einer für 3D angepassten Form der Technik. Erfahre mehr über die Geschichte und Funktionsweise dieser einfachen, aber wirkungsvollen Technologie.

Was ist ein Zoetrop, und wie funktioniert es?
Ein Zoetrop besteht aus einer Trommel mit vertikalen Schlitzen. An der Innenwand der Trommel ist ein Streifen mit einer Folge von Bildern angebracht. Dreht sich die Trommel, können Betrachter die Bilder durch die Schlitze sehen. Die Schlitze verhindern, dass die einzelnen Bilder verschwimmen, gleichzeitig entsteht durch die schnelle Abfolge der Bilder der Eindruck von Bewegung.
Geschichte.
- 1833 stellten der belgische Physiker Joseph Plateau und der österreichische Erfinder Simon Stampfer unabhängig voneinander das Phenakistiskop (auch Wunder- oder Lebensrad genannt) vor. Die drehbare Scheibe gilt als erstes Gerät zur Animation von Bildern, das große Verbreitung fand. Im Juli desselben Jahres wies Stampfer bereits darauf hin, dass die Technik auch auf Trommeln oder gewundene Papierstreifen übertragbar wäre.
- Der britische Mathematiker William Horner erstellte daraufhin 1834 den ersten Typ eines Zoetrops. In Anspielung auf die Figur Daedalus aus der griechischen Mythologie nannte er das Gerät Daedalum. Im Gegensatz zu späteren Versionen, bei denen die Schlitze über den Bildern platziert waren, befanden sich die Schlitze in Horners Drehtrommel zwischen den Bildern.
- 1867 meldete William Lincoln den Namen Zoetrop zum Patent an. Der Begriff, eine Kombination aus den griechischen Wörtern zoe (Leben) und tropos (drehend), bedeutet so viel wie „Rad des Lebens“.
- Der Brettspielhersteller Milton Bradley verkaufte die ersten Trommeln in den USA. Im Vereinigten Königreich wurden ähnliche Versionen durch die London Stereoscopic and Photographic Company vertrieben. Die Trommeln wurden zu einem beliebten Spielzeug in vielen viktorianischen Haushalten. Die Kinder wurden es nicht müde, die animierten Bilder von galoppierenden Pferden und anderen Tieren im Zoetrop zu verfolgen.
- Bald darauf wurde ein riesiges, per Gasmotor angetriebenes Zoetrop mit einem Umfang von gut 15 m im Londoner Crystal Palace ausgestellt.
- Weitere Animationsgeräte wie das Praxinoskop (Zaubertrommel) folgten. Auch das Daumenkino wurde in dieser Zeit patentiert. Nach demselben Grundprinzip wie beim Zoetrop und ähnlichen Erfindungen entstanden schließlich Ende der 1880er-Jahre die ersten Filmaufnahmen.
- Im späten 20. Jahrhundert erlebten Zoetrope eine Renaissance und Weiterentwicklung – möglicherweise als Reaktion auf das Aufkommen der digitalen Technologie. Der Animationskünstler Eric Dyer erfand eine eigene Version, indem er ganz auf die Trommel verzichtete und anstelle von Schlitzen mit der kurzen Belichtungszeit einer Kamera arbeitete. Seine experimentellen Filme aus 3D-Skulpturen nannte er „Cinetrope“.
- Das Revival der Zoetrope brachte immer größere, aufwendiger gestaltete Modelle – bis hin zu 3D-Versionen hervor. Pixar Animation Studios erstellte ein 3D-Zoetrop mit Figuren aus Toy Story 2 (1999), das in Museen und Galerien weltweit ausgestellt wurde.
- Das Internet-Phänomen der GIF-Animation mit ihren kontinuierlich abgespielten Bildfolgen stellt eine Art modernen Nachfolger des Zoetrops dar.
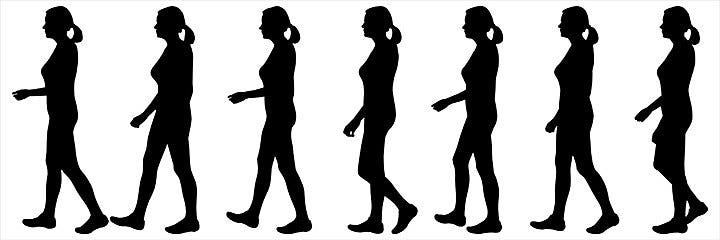
Beispiele.
- 2012 entwickelte das Berliner Animationsstudio Sehsucht ein CGI-Zoetrop in Form eines 3D-Karussells, das den amerikanischen Traum verkörperte.
- 2008 schuf das britische VFX-Unternehmen Artem Limited ein 10 m breites, 10 t schweres Zoetrop für Sony. Das BRAVIA-Drome mit 64 Bildern des brasilianischen Fußballers Kaká wurde vom Guinness-Buch der Rekorde zum größten Zoetrop der Welt erklärt.
- Im amerikanischen Horrorfilm Haunted Hill (1999) ist eine menschengroße Zoetrop-Kammer, die sogenannte „Reizsättigungskammer“, zu sehen.
- Das Ghibli Museum in Tokio beherbergt ein 3D-Zoetrop mit Charakteren aus dem Film Mein Nachbar Totoro, den das japanische Animationsstudio 1988 herausgebracht hat.
- Das „Toy Story“-Zoetrop von Pixar wurde nach dem Vorbild von Ghibli erstellt und inspirierte seinerseits zwei weitere 3D-Zoetrope. Eines davon befindet sich in den Walt Disney Studios im kalifornischen Burbank, das andere in Disneyland Paris.
- Im 2012 erschienenen Horrorfilm Die Frau in Schwarz blickt die Titelfigur in ein Zoetrop, das vom Schauspieler Daniel Radcliffe in Bewegung versetzt wird.
- Von 2007 bis 2014 strahlte der Sender BBC Two vor TV-Programmen und auf dem BBC iPlayer ein Ident in Form eines Zoetrops aus, das fliegende Autos in einer futuristischen Stadtkulisse zeigt.
- Im Mystery-/Horrorfilm Conjuring 2 (2016) kommt ein von einem Dämonen besessenes Zoetrop-Spielzeug vor.
- Das Bekleidungsunternehmen The Gap erstellte für seine „Meet Me in the Gap“-Kampagne ein menschengroßes Zoetrop. Das riesige, mehrfarbige Rad zeigt Menschen, die auf der Stelle tanzen. In Verbindung mit der drehenden Trommel und dem 360-Grad-Aufnahmewinkel entstand daraus ein immersives Kaleidoskop aus Bewegung und Farbe.
- Das amerikanische Performance-Kunst-Kollektiv „The Blue Man Group“ erzeugte bei seinen Shows in Las Vegas und Florida mit einem schnell drehenden Karussell einen Zoetrop-Effekt.
- Die britische Supermarktkette Sainsbury’s feierte ihren 150. Geburtstag 2019 mit einem TV-Spot mit einer riesigen Zoetrop-Torte.
- Die New Yorker Werbeagentur Johannes Leonardo erstellte 2021 für Volkswagen den Werbe-Spot The Wheel mit acht komplexen Zoetropen, die jeweils einen bestimmten Aspekt aus der Evolutionsgeschichte des Beförderungswesens darstellten. Für jedes Zoetrop kamen verschiedene Gestaltungstechniken zum Einsatz, darunter Bildhauerei, Handzeichnung, Cel- oder Folienanimation, Fotografie und 3D-Stop-Motion.
Ein Zoetrop bauen.
Alle, die keinen Zugang zur High-End-Technologie der Studiogiganten Ghibli oder Pixar haben, bauen sich ihre Wundertrommel mit wenigen Mitteln einfach selbst.

Benötigte Materialien.
- Zoetrop-Vorlage. Im Internet findest du viele Templates, die du verwenden oder als Inspirationsquelle nutzen kannst. Besonders beliebt sind galoppierende Pferde.
- Ein Essstäbchen. Du kannst ein Stäbchen vom China-Imbiss verwenden oder online gleich eine ganze Packung bestellen. Letzteres ist sinnvoll, wenn du vorhast, mehrere Zoetrope zu bauen.
- Eine CD. Wahrscheinlich streamst du deine Musik auch nur noch. Hier hast du eine Möglichkeit zur Verwertung alter CDs.
- Zwei Unterlegscheiben, verzinkt (ca. 3 mm x 25 mm). Du bekommst sie in den meisten Eisenwarenläden oder im Internet.
- Schere
- Klebeband
Das Zoetrop erstellen.
- Die Streifen vorbereiten. Schneide die Streifen deiner Vorlage aus. Falte beide Streifen an den gestrichelten Linien. Schneide dann für die Schlitze auf beiden Streifen die markierten Rechtecke aus. Hefte die Blätter mithilfe von Klebeband zusammen.
- Die Streifen zusammenfügen. Füge die Blätter so zusammen, dass ein Kreis entsteht. Die Bilder müssen auf der Innenseite sein. Achte darauf, dass das Klebeband nicht auf die Innenseite gerät. Befestige dann die Außenseite der Trommel am Rand der CD. Versuche, den Kreis so rund wie möglich zu halten und Wölbungen zu vermeiden.
- Das Zoetrop zusammenbauen. Schiebe eine der Unterlegscheiben fest über das spitze Ende des Essstäbchens. Setze die CD so auf die Unterlegscheibe, dass der Zoetrop-Streifen nach oben zeigt. Schiebe dann die zweite Unterlegscheibe über das spitze Ende des Essstäbchens, sodass sich die CD zwischen den beiden Scheiben befindet. Befestige die obere Unterlegscheibe mit einem kleinen Stück Klebefilm am Essstäbchen. Achte darauf, dass du sie nicht an der CD festklebst.
- Das Zoetrop verwenden. Halte dein Zoetrop leicht schräg. Versetze die CD in Drehung, und blicke durch die ausgeschnittenen Schlitze. Die Bilder im Inneren scheinen sich nun zu bewegen. Erfolgt die Bewegung rückwärts, drehe die CD einfach in die entgegengesetzte Richtung. Eventuell dauert es einige Zeit, bis du die richtige Drehgeschwindigkeit herausgefunden hast und die Animation optimal zu sehen ist.
Ideen.
Die besten Ideen für Zoetrope drehen sich (buchstäblich) um ganz einfache Bewegungen. Beispiele:
- Tiere. Galoppierende Pferde, marschierende Elefanten, fliegende Vögel, springende Löwen, schwimmende Fische.
- Menschen. Tänzer, Gewichtheberinnen, Jongleure, Athletinnen, Kinder, Cartoon-Figuren.
- Formen. Kleiner und größer werdende Sterne oder Kreise, umfallende Kegel.

Du könntest auch ein 3D-Zoetrop aus Modellen und statischen Skulpturen erstellen. Mit einem drehenden Plattenteller, Pfeifenreinigern, Pappmaché und einem Stroboskop lassen sich 3D-Zoetrope ganz ohne 3D-Drucker erstellen.
Häufig gestellte Fragen.
Aus wie vielen Bildern besteht ein Zoetrop?
Je mehr Bilder pro Sekunde dem Auge präsentiert werden, desto besser gelingt die Illusion. Ideal sind 24 Bilder pro Sekunde, das Minimum liegt bei 12 Bildern pro Sekunde. Bei einem schnell rotierenden Zoetrop mit einer Drehung pro Sekunde braucht es 12 Bilder, um einen flüssigen Ablauf zu erzielen. Allerdings macht gerade das Ruckeln und Flackern oft einen großen Teil des Retro-Charmes dieser Technik aus.
Wer hat das Zoetrop erfunden?
Die Anfänge des Zoetrops gehen auf den österreichischen Erfinder Simon Stampfer zurück. Er gehörte 1833 zu den Entwicklern des Phenakistiskops, eines der ersten Geräte für bewegte Bilder, das große Verbreitung fand. Stampfer schlug auch als Erster die Verwendung einer Trommel vor. Ein Jahr später erfand der britische Mathematiker William Horner das Daedalum. In seiner endgültigen Form wurde das Zoetrop 1865 vom amerikanischen Erfinder William Lincoln entwickelt und zwei Jahre später patentiert.
Wie schnell sollte sich ein Zoetrop drehen?
Ein typisches Zoetrop rotiert mit weniger als 100 Umdrehungen pro Minute. Ein Jo-Jo erzielt im Vergleich dazu Geschwindigkeiten von bis zu 5.000 U/min. Das relativ langsame Tempo des Zoetrops macht einen großen Teil seines einzigartigen Reizes für Animatoren und Animatorinnen sowie die Betrachtenden aus.